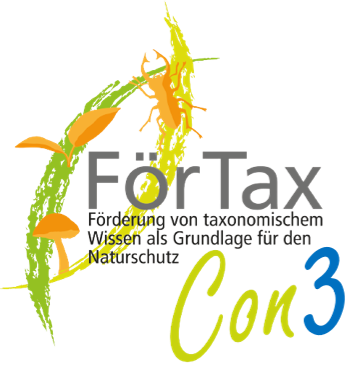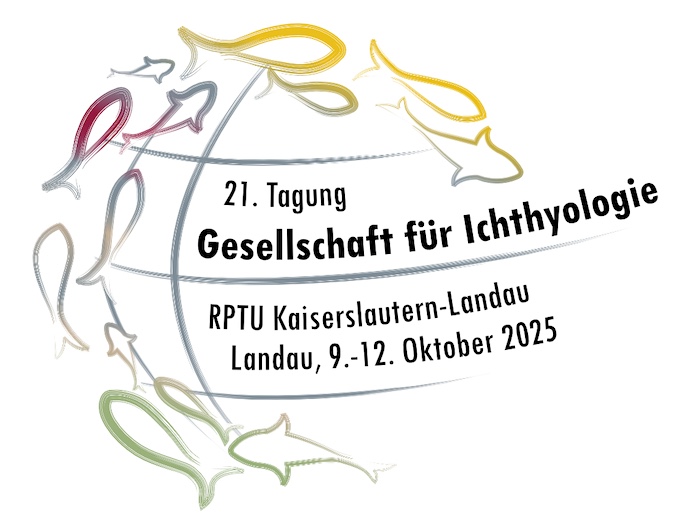aus VBIO – Aktuelles aus den Biowissenschaften

Extremereignisse verändern die Ökologie im Meer sprunghaft: Eine einzige marine Hitzewelle im Jahr 2003 hat beispielsweise Artenzusammensetzung und Nahrungsnetz-Beziehungen im Nordatlantik so beeinflusst, dass die Folgen bis heute wirken.

Die Lodde (oben links) gehört zu den Verlierern, wenn sich das Ökosystem ändert. Copyright: Thünen-Institut/Karl-Michael Werner
Zunächst erscheint es erstaunlich, dass diese Erkenntnisse bisher unentdeckt blieben. Die Ursache liegt darin, dass oft nur prominentere Arten wie Pflanzen und Wirbeltiere untersucht werden. Die Trierer Forschenden weiteten das Spektrum aber auf deutlich kleinere Ebenen wie Pilze, Plankton, Algen oder Gliederfüßer aus, von denen sie zehntausende Arten untersucht haben. Diese spielen in der Nahrungskette eine unverzichtbare Rolle.
Die Ökologie des Nordatlantiks ist im ständigen Wandel. Manchmal verändert sie sich jedoch sprunghaft. Ein Grund: sogenannte Extremereignisse. Ein Beispiel dafür sind marine Hitzewellen. Ein Forscherteam unter der Leitung des Thünen-Instituts für Seefischerei hat jetzt herausgefunden, dass eine einzige, weiträumige Hitzewelle im Jahr 2003 die Artenzusammensetzung und die Nahrungsnetz-Beziehungen im subpolaren Nordatlantik bis heute nachhaltig beeinflusst. Die Studie wurde jetzt in Science Advances veröffentlicht. „Die Auswirkungen eines solchen Ereignisses reichen bis an uns Menschen heran, weil sie die Verbreitung von Fischarten, die wir essen und an die der Fischfang seit Jahrzehnten angepasst ist, ändern“, erläutert Dr. Karl-Michael Werner vom Thünen-Institut für Seefischerei, Erstautor der Studie. Derartige physikalische Extremjahre könnten auch in Zukunft plötzliche und unvorhersehbare Auswirkungen auf das Leben im Ozean haben. Die Frage sei nun, unter welchen Bedingungen sich eine derart großflächige Hitzewelle mit so weitreichenden Folgen wiederhole. „Nach 2003 gab es weitere Hitzewellen, die aber keine nennenswerten Veränderungen hervorgerufen haben“, sagt Werner.
Ein „perfekter Sturm“ wirkt bis heute nach
Die Forschenden haben untersucht, wie sich ein weiträumiges Extremereignis im Meer auf Artengemeinschaften und die Verbreitung einzelner Organismen auswirkt. Dafür haben sie rund 100 Zeitreihen untersucht, die biologische Kennzahlen enthielten. Unter anderem kamen wesentliche Daten aus der Wassersäule und vom Tiefseeboden vom LTER (Long-Term Ecological Research) Observatorium HAUSGARTEN des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI). Dort in der Framstraße zwischen Grönland und Svalbard finden seit mittlerweile 25 Jahren ökologische Langzeituntersuchungen statt. Ein Großteil der untersuchten Parameter zeigte abrupte Änderungen im Jahr 2003 oder kurz danach. In dem Jahr fand ein sogenannter „perfekter Sturm“, eine Kombination aus Ereignissen mit besonders dramatischen oder überraschenden Auswirkungen, im und über dem subpolaren Nordatlantik statt. Während sich eine ungewöhnlich große Menge warmen, subtropischen Wassers zwischen Island und Schottland ihren Weg nach Norden bahnte, strömten ebenso ungewöhnlich kleine Mengen arktischen Wassers östlich von Grönland südwärts. Im selben Jahr erreichte die Atmosphäre über demselben Gebiet rekordheiße Temperaturen. Die Auswirkungen waren bis nach Zentraleuropa spürbar, wo tausende Menschen an den Folgen von Hitzewellen starben. Diese Kombination führte dazu, dass auch die Meerestemperatur im Nordatlantik zwischen Westgrönland und der norwegischen Küste Rekordwerte erreichte.
Von einzelligen Algen bis zu Walen – kein Lebewesen blieb von der plötzlichen Wärme verschont. Während sich Fischarten wie Kabeljau und Schellfisch nach Norden ausbreiten konnten, weil sich zurückziehendes Eis und höhere Temperaturen Lebensraum freigaben, fing die Lodde an zu leiden. Der wichtigste Futterfisch für höhere Ebenen im Nahrungsnetz des subpolaren Nordatlantiks verschob sein klassisches, südwestlich vor Island liegendes Laichgebiet nach Norden. Mit schwerwiegenden Folgen: Eier und Larven der Lodde treffen auf neue Strömungsmuster. Sie treiben nun bis an die Küste Ostgrönlands. Dort treffen sie auf ungleich schwierigere Lebensbedingungen, an die der Lebenszyklus der Art nicht angepasst ist. Nur wenige Eier und Larven überleben die ungewohnten Bedingungen. Gewinner auf der anderen Seite sind Wale, etwa der Buckelwal. Er kann den Lodden nun folgen und ist nach mehr als 150 Jahren wieder ein regelmäßiger Besucher Südostgrönlands.
Auch eine ungefähr zwei Jahre nach dem „perfekten Sturm“ einsetzende Wärmephase in der Framstraße zwischen Svalbard und Grönland, tausende Kilometer von der eigentlichen Rekord-Stelle gelegen, konnten die Autor*innen erstmals damit in Verbindung bringen. Das warme Wasser brachte neuen Organismen mit, die von der Oberfläche bis zum Meeresboden das gesamte Ökosystem abrupt veränderte. Das warme Wasser sorgte für mehr Biomasse, die abgestorben zum Meeresgrund sinkt. Dort dient sie Sediment-Bewohnern wie Schlangenstern und Fadenwurm als Nahrung. Allerdings heißt mehr nicht automatisch besser. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Nährstoffqualität in der sinkenden Biomasse im gleichen Zeitraum abnahm.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass unerwartete Extremereignisse nicht vorhersehbare ökologische Kaskaden auslösen“, sagt Werner. Wie sich die Umwelt durch die erwartete Erwärmung verändern wird, wisse aktuell niemand. Man könne zwar vorhersagen, wie steigende Temperaturen den Stoffwechsel von Organismen beeinflussen und mitunter begünstigen. Aber wenn eine Art sich deshalb nach Norden bewege und dort entweder gefressen wird oder keine passenden Laichgründe findet, werde sie nicht davon profitieren. Die einzigen Arten, die sich immer wohl fühlen, seien die typischen Opportunisten, wie der Kabeljau. „Sobald die Umwelt es einigermaßen zulässt, breitet der sich aus und frisst alles, was ihm in den Weg kommt“, sagt der Wissenschaftler.
Thünen-Institut für Seefischerei
Originalpublikation:
Karl Michael Werner, Ismael Núñez-Riboni, Thomas Soltwedel, Raul Primicerio, Margrete Emblemsvåg (2025). Major heatwave in the North Atlantic had widespread and lasting impacts on marine life, Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.adt7125