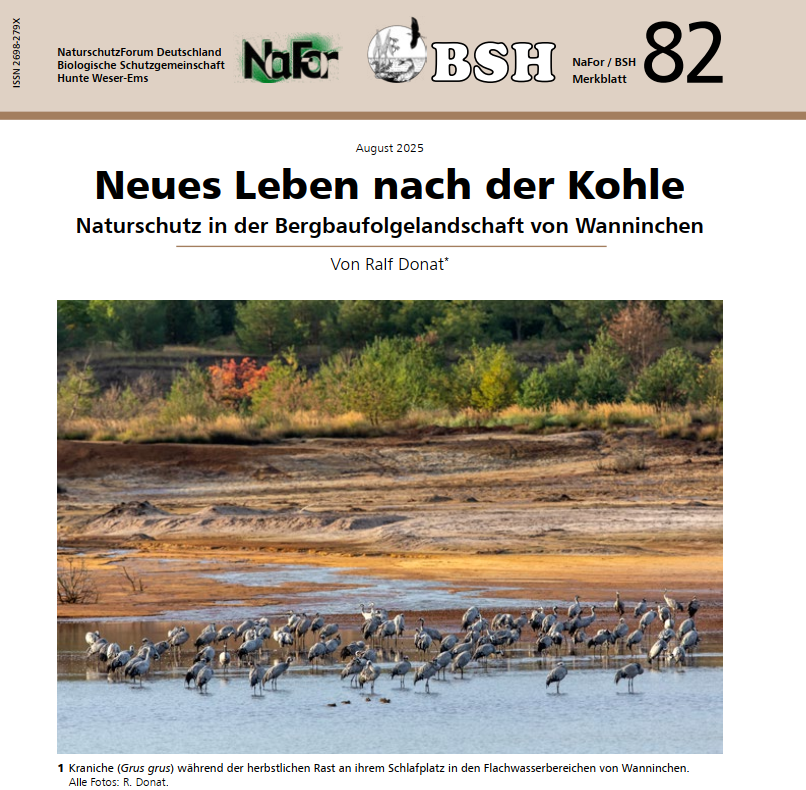1. Paludikulturen ersetzen keinen Artenschutz in Mooren
Naturschutzforum fordert die Erhaltung alter Torfstiche zugunsten auch trockenheitsabhängiger Arten wie Reptilien und Schmetterlinge
Wardenburg / Diepholz / Emsland. Das Naturschutzforum Deutschland (Nafor) sieht keinen Vorteil in der derzeit politisch vorangetriebenen übermäßigen Vernässung von Moorstandorten. Besonders gefährdet sind vor allem Refugialräume von Wirbeltieren, die sich als Kulturflüchter in anmoorige Standorte zurückgezogen haben. Viele der heute in den ehemaligen deutschen Hochmooren lebenden Arten sind mooruntypisch, so NaFor. Das betrifft Singvogelarten wie Fitislaubsänger und Neuntöter ebenso wie Brachvögel, Bekassine und andere Schnepfen. Besonders hart würden Veränderungen durch ansteigende Wasserstände die trockenheitsliebenden Arten treffen. Beispiele sind Schlingnattern und Eidechsen, aber auch Schmetterlinge wie den Heidekrautbürstenbinder, deren Weibchen ähnlich wie bei Glühwürmchen nicht fliegen können. Hier muss äußerst sensibel vorgegangen werden. Wird einmal zu hoch angestaut, ertrinken die auf trockene oder mäßig feuchte Standorte angewiesenen Arten.
Die Umwandlung von artengeschützen Moor- und Nachbarstandorten hin zu dauernassen Arealen ist daher nach Auffassung des NaFor mit dem Bundesnaturschutzgesetz und dem Tierschutzgesetz kaum vereinbar. Deshalb ist auch die großflächige Umsetzung der Paludikultur aus Artenschutzgründen sehr kritisch zu sehen und eine Höherbewertung von Klimaschutzaspekten keinesfalls gerechtfertigt. Zudem ist fraglich, ob der Torfmoosanbau tatsächlich eine funktionierende torferhaltende Bewirtschaftungsform sein kann. Erfahrung auf Versuchsflächen im Landkreis Oldenburg zeigen, dass oft eher Binsen die Oberhand auf diesen Flächen gewinnen. Angesichts der heimischen Not an Platz und geeigneten Flächen appelliert das Naturschutzforum an alle Behörden, die eine Umwidmung von jahrzehntealten Ruhezonen zu Paludiflächen planen, diese Vorhaben angesichts der erheblichen Störungen und Schäden nicht in die Tat umzusetzen. Ebenso kritisch sieht das Nafor ein ingenieurtechnisches Aufrechnen und Vergleichen von Klimaleistungen von Mooren und Waldgebieten. Nafor favorisiert die Förderung von Naturwäldern und Nutzgehölzen mit standort- und klimageeigneten Pflanzen, die Lebensgemeinschaften im überregionalen Verbund bilden und sich bestmöglich in Abstimmung mit den vorhandenen Wirtschaftsformen in ein abwechslungsreiches Mosaik mit möglichst gemischten Nutzungen zu entwickeln.
Die Details zum Bestandsschutz von Lebensgemeinschaften und speziellem Arteninventar sind der untenstehenden weiterführenden Literatur aus dem Diepholzer Moor und emsländischen Mooren zu entnehmen.
Haverkamp, Michael (2022): Ein Glücksfall – Artenreiches Moor. Kartierung der vorhandenen Flora und Fauna in den Naturschutzgebieten des Naturpark Moor.- Emsland Moormuseum e.V., Geestmoor 6, 49744 Geeste / Groß-Hesepe, 132 S., ISBN 978-3-89946-320-0; www.dnb.d-nb.de
Akkermann, Remmer (1982): Regeneration von Hochmooren – Zielsetzungen, Möglichkeiten, Erfahrungen.- Tagungsband. Informationen zu Naturschutz und Landschaftspflege. 3, 335 S., BSH Wardenburg
2. Naturschutzforum Deutschland kritisiert die Verpressung von Kohlendioxid in den Untergrund
Wardenburg. Kohlendioxid (CO2) benötigen chlorophyll-aktive Pflanzen zur Produktion von Zucker, begleitet von der Bildung von Sauerstoff. Atmende Lebewesen wiederum benötigen Sauerstoff und geben CO2 wieder ab. Dieses natürliche Gleichgewicht wird durch die anhaltende Verbrennung fossiler Brennstoffe im industriellen Maßstab gestört. Extreme Überschüsse von CO2 wurden und werden in der Atmosphäre angereichert und sind verantwortlich für den Klimawandel. Vor allem Industrie, Kohle- und Gaskraftwerke und die Verbrennertechnik in Fahrzeugen aller Art emittieren CO2. Es bedarf dringend der Gegensteuerung zur Reduzierung. Das kann über energiesparende Techniken erfolgen, durch den Verzicht auf Fern- und Kurzstreckenflüge, die Reduzierung des Fleischverzehrs und anderes mehr. Die notwendige Dekarbonisierung erfolgt nur langsam, die Bilanzen sind nach wie vor negativ.
Eine verstärkt favorisierte Möglichkeit, den CO2-Anteil zu reduzieren, ist die CCS-Technologie, d.h. die Verpressung und Lagerung von CO2 in tief gelegene Lückensysteme des Meeresbodens. Das Naturschutzforum Deutschland (nafor.de) lehnt CCS ab, da es sich um eine unerprobte Risikotechnologie handelt, die nicht dazu beiträgt, die Klimaveränderungen zu dämpfen. Im Gegenteil, so das NaFor, die kosten- und energieintensive CCS-Technologie würde dazu verleiten, weiterzumachen wie bisher und die dringend notwendige Dekarbonisierung zu verzögern. In der Folge würden Gletscher noch schneller schmelzen, sich der Meeresspiegel immer mehr erhöht und zusätzlich mit dieser Technologie unkalkulierbare Risiken in Kauf genommen werden.
Verbände wie die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste warnen nachdrücklich vor dieser Entwicklung. Gemeinsam wird darauf gedrungen, endlich schneller auf die energiesparenden Techniken beim Wohnen und Versorgen zu setzen, ungleich schneller damit voranzukommen und die bekannten Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz gemeinsam mit der Bevölkerung umzusetzen.
Bezug genommen wird auf Pressemeldungen der
Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V. (SDN), z.B. vom 07. 07. 2025: Industriegebiet Nordsee – Gewerbepark oder Naturraum? Weiteres siehe www.sdn-web.de
3. Naturschutzforum fordert beschleunigte Bearbeitung der Durchfahrtsrechte für den Öltanker Eventin
Rügen / MV. Der vor der Ostseeinsel Rügen festgesetzte Öltanker Eventin dümpelt seit Monaten den stürmischen Zeiten an der Ostsee entgegen. Vollbeladen wartet das der russischen Schattenflotte zugeordnete Schiff auf die Genehmigung der Weiterfahrt. Das Naturschutzforum Deutschland (Nafor) hält es angesichts der hohen Risiken aus ökologischen Gründen für unvertretbar, das Schiff dort zu belassen, anstatt es unverzüglich in einen Hafen zu verbringen oder sofort weiterfahren zu lassen.
Sollte es zum Austreten von Öl kommen, wäre auch die Tourismuswirtschaft über Jahre schwer geschädigt. Das Naturschutzforum sieht darin eine hochgradige „Gefahr im Verzuge“ und fordert von Seiten der Bundesregierung sofortiges Handeln vor Ort. Die notwendige Klärung der hier gegebenen komplizierten Rechtsverhältnisse sollte von Seiten der EU über eine Ausnahmegenehmigung nach der Beseitigung der Gefahrenlage erfolgen.
Wie man schnell reagieren kann, zeigten 2023 die Niederländer. Am 26. Juli 2023 havarierte die Autofähre Fremantle Highway mit 3.784 Fahrzeugen an Bord und wurde schnellstmöglich in den Hafen Eemshaven geschleppt und abgewrackt. Was an Natur- und Tourismuswerten auf dem Spiel gestanden hätte, stellte Nafor 2023 mit Fotos aus Schleswig-Holstein dar.
Der Bericht nimm Bezug auf:
Naturschutzforum Deutschland e.V. (20. 08. 2023): Mehr Abstand zum Nationalpark Wattenmeer. Naturschutzforum fordert Begrenzung der Schiffsgrößen und Sonderregelungen. www.nafor.de (Pressemitteilungen).
Greenpeace (11.11.2025): Greenpeace zeigt mit Simulation; Havarie des Öltankers “Eventim” hätte Ostsee-Ökosysteme schwer beschädigt. www.presseportal.greenpeace.de/257422
NDR Tagesschau (11.11.2025): Öltanker Eventin – Warten auf die Katastrophe? www.tagesschau.de